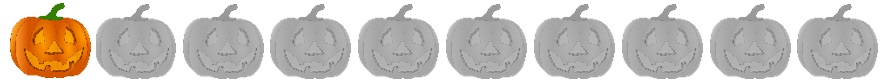Regie: Christopher Nolan
Original-Titel: Oppenheimer
Erscheinungsjahr: 2023
Genre: Biopic, Drama, Historienfilm
IMDB-Link: Oppenheimer
Christopher Nolan ist vielleicht der kompromissloseste Regisseur unserer Zeit. Er macht keine halben Sachen. Ein dreistündiges Biopic über einen theoretischen Physiker? Warum nicht? Es ist Nolans große Kunst, dass er diese drei Stunden so spannend gestaltet wie einen Thriller und so kurzweilig, als würde er maximal zwei Stunden dauern. Lediglich das Steißbein verkündet gegen Ende des Films die tatsächliche Sitzdauer. J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), wie gesagt theoretischer Physiker in den USA, gilt heutzutage als „Vater der Atombombe“. Mitten im Nirgendwo stampfte er während des Krieges mit den Mitteln des Militärs (verkörpert durch Matt Damon als General Groves ) die Forscherstadt Los Alamos aus dem Boden, um dort in zwei Jahren die Atombombe zu entwickeln, bevor den Nazis, die ebenfalls daran forschen, der Durchbruch gelingt. Um sich versammelt er die besten Köpfe der Physik samt deren Familien, um das Unmögliche möglich zu machen. So weit, so gut bzw. so bekannt. Was Nolan allerdings aus dem an sich drögen Stoff macht, ist überwältigendes Kino. Wie so oft in seinen Filmen sind unterschiedliche Zeitstränge miteinander verwoben. Die eigentliche Rahmenhandlung bildet eine Befragung eines Ausschusses in einem Hinterzimmer nach dem Krieg zu Oppenheimers Sympathie für den Kommunismus mit dem Ziel, ihn, den Star der Wissenschaft und Berater des Kabinetts, zu diskreditieren und ihm seine Sicherheitsstufe zu entziehen. Eingewoben ist hierbei ein kurzer biographischer Exkurs, die Arbeit an der Bombe selbst und eine weitere Anhörung in der Zukunft, diesmal seinen Förderer und Mentor, den ehemaligen Leiter der Atomenergiekommission Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), betreffend. Es liegt an Nolans penibler Regie, dass diese Zeitstränge genuin so miteinander verwoben sind, dass man nach einiger Eingewöhnung gut den Überblick behält. Gleichzeitig erforscht Nolan auch das Innenleben des genialen, aber schwierigen Wissenschaftlers Oppenheimer. Unter Nolans Blick bleibt dieser bis zum Schluss eine ambivalente Figur, die sich völlig im Klaren darüber scheint, was die Erfindung der Atombombe bedeutet, dennoch aber fast schon besessen auf dieses inhumane Ziel hinarbeitet. Eine der intensivsten Szenen des Films spielt sich ab, als der Verteidigungsminister samt seinem Stab, dem auch Oppenheimer beratend angehört, fast kaltblütig mathematisch das Für und Wider des Abwurfs einer Atombombe auf Japan und die Frage nach den „besten“ Zielen erörtert. Die Hintergründe für diese letztlich geschichtsverändernde Entscheidung werden dadurch greifbar, was den Schrecken über die Konsequenzen dieser Handlung allerdings in keinster Weise mindert. „Oppenheimer“ ist ein klarer Anwärter auf den Film des Jahres. Mich würde es wundern, wenn er während der Award-Season nicht abräumen würde, was es abzuräumen gibt. Und ich rechne mit einem Regen an Nominierungen für die Oscars Anfang nächsten Jahres: Cillian Murphy, Robert Downey Jr. scheinen gesetzt zu sein, dazu vielleicht sogar noch Emily Blunt und/oder Florence Pugh, dazu erwarte ich Nominierungen für den besten Film, die beste Regie, den besten Schnitt, die besten Visual Effects, den besten Ton, die beste Kamera, die beste Maske und die beste Musik. In einigen Monaten werden wir sehen, ob die Rechnung aufgeht.

9,0 Kürbisse
(Bildzitat: Foto von Universal Pictures – © Universal Pictures. All Rights Reserved, Quelle http://www.imdb.com)