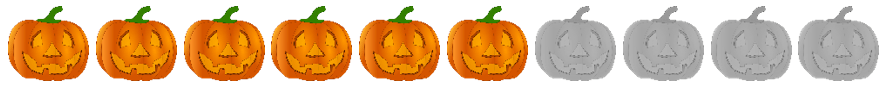Regie: Andrew Haigh
Original-Titel: All of Us Strangers
Erscheinungsjahr: 2023
Genre: Drama, Liebesfilm
IMDB-Link: All of Us Strangers
Ein einsamer, homosexueller Drehbuchautor in einem kalten und verlassenen Appartement-Hochhaus in London. Das Leben zieht an ihm vorbei, die Tage sind gleichförmig und werden vorrangig auf der Couch verbracht, während über den Fernseher alte „Top of the Pops“-Folgen flimmern. Eines Tages klopft der einzige Mitbewohner dieses sterilen Hauses an der Tür: Betrunken, ebenfalls vereinsamt und nach Liebe und Geborgenheit suchend. Adam, der Schriftsteller, ist jedoch zu feige und schließt die Tür zunächst wieder. Doch die Neugier siegt, und bei der nächsten Begegnung lässt er sich auf die Avancen des jungen Harry ein. Was zunächst wie eine queere Liebesgeschichte in Anonymität der Großstadt beginnt, entfaltet sich unter Andrew Haighs sensibler Regie bald zu einer Studie von Vereinsamung, Trauer und Verlust. Denn bei einem Besuch seiner Geburtsstadt macht Adam bald eine unerwartete Begegnung: Er trifft auf seine Eltern, die sich im gleichen Alter wie er selbst befinden. Ein Traum? Eine Geistererscheinung? Eine Parallelwelt? Und kann ihm die aufkeimende Liebe zu Harry Halt geben in einer Situation, die Adam zu verschlingen droht? Langsam, aber keinesfalls langatmig tastet sich Haigh mit seinem grandios aufspielenden Cast vorwärts und entfaltet nach und nach das eigentliche Thema des Films bis hin zu seinem bitteren und aufwühlenden Ende. So großartig „All of Us Strangers“ auch inszeniert ist mit seinen weichen, zärtlichen Kamerabildern, dem klug eingesetzten Sounddesign und dem dichten Drehbuch, das der Geschichte dennoch genügend Raum zum atmen lässt, er würde nicht funktionieren ohne der überragenden Leistung des Casts, allen voran Andrew Scott in der Hauptrolle des Adam. Aber auch Paul Mescal als Harry sowie Claire Foy und Jamie Bell als Eltern tragen ihre Figuren mit größtmöglicher Sensibilität und Menschlichkeit und machen „All of Us Strangers“ zu einem gefühlsbetonten Drama, das mit zwar am Überirdischen anstreift, doch dank eben dieser ambivalenten und komplexen Figuren die Beine fest auf dem Boden behält.

8,0 Kürbisse
(Bildzitat: Foto von Chris Harris/Chris Harris, Quelle: http://www.imdb.com)