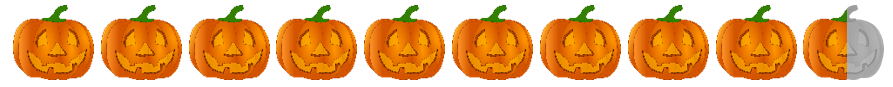Regie: Edward Berger
Original-Titel: Conclave
Erscheinungsjahr: 2024
Genre: Drama, Thriller, Politfilm
IMDB-Link: Conclave
Die katholische Kirche macht im Grundsatz schon viel richtig zur Unterhaltung des Pöbels: Mit viel Brimborium werden seltsame, unverständliche Rituale exerziert, Männer stecken in lustigen und farbenprächtigen Gewändern, mit denen sie sich am Kölner Karneval unters Volk mischen könnten, und die Wahl des Chefs erfolgt in einem streng geheimen Verfahren, von dem man nichts mitbekommt außer: „Weißer Rauch: Habemus Papam!“ und „Schwarzer Rauch: Die Kardinäle sind sich nicht einig und holen sich jetzt erst einmal eine Leberkässemmel.“ Nichts geht über gut dosierten Mystizismus, um die Massen zu begeistern. Dieses Geheimnis der Konklave, also der Papst-Wahl, setzt Edward Berger, mit einem Oscar geadelt für Im Westen nichts Neues, mit hochkarätiger Besetzung filmisch um. Herzstück des Films ist Dekan Lawrence (Ralph Fiennes einmal mehr mit einer preiswürdigen Leistung), ein tugendhafter Zweifler, dem nach dem Ableben des von ihm sehr geschätzten Papstes mit der Aufgabe der Durchführung der Konklave beauftragt ist. Ihm zur Seite steht der bescheidene und progressive Kardinal Bellini (Stanley Tucci, ebenfalls grandios), der auf gar keinen Fall Papst werden will und genau deshalb aber seine Anhänger hat. Ihm diametral gegenüber steht der erzkonservative Kardinal Tedesco (Sergio Castellitto), der die katholische Kirche wieder ins Mittelalter zurückschießen möchte. Und auch sonst mischen ehrgeizige Kandidaten in der Wahl mit, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Bald geht es weniger darum, einen geeigneten Kandidaten zu ermitteln, sondern zu verhindern, dass eines der vielen schwarzen Schafe, die da im Ornament herumturnen, den Thron von Rom erklimmt. Die Konklave wird zum Jahrmarkt der Eitelkeiten, und ja, das Muster lässt sich übertragen: Alte, gut situierte Männer sind vor allem an der Macht interessiert, und der Weg dahin darf durchaus durchs moralische Dickicht führen, durch das sich sonst keiner traut, wenn das Ziel damit erreicht werden kann. Dass der Film so gut funktioniert, verdankt er neben geschliffenen Dialogen und einem wunderbaren Cast (auch zu erwähnen: Isabella Rossellini mit einer kleinen, aber prägnanten Rolle, Lucian Msamati, John Lithgow und Carlos Diehz, die allesamt ihre Momente haben) vor allem aber seiner Verweigerung eines moralisch erhobenen Zeigefingers, der angesichts so mancher Fehltritte der katholischen Kirche durchaus angebracht erschiene. Edward Berger beobachtet und erzählt, er urteilt nicht. Vielmehr vertraut er darauf, dass die Kraft der Bilder und der Erzählung für sich sprechen und einen möglichen Weg aufzeigen. Gerade in dieser Hinsicht ist „Konklave“ durchaus ein moralischer Film, nur eben ohne Maßregelungen und Überheblichkeit. Das gepaart mit einer eindrucksvollen Kamerarbeit, die virtuos mit dem Raum und dessen Begrenzungen arbeitet, sowie einem eingängigen Soundtrack, der die Spannung des Geschehens untermalt, macht „Konklave“ zu einem exzellenten Film und würdigen Anwärter auf den Oscar für den besten Film des Jahres.

8,0 Kürbisse
(Bildzitat: Foto von Courtesy of Focus Features. © 2/Courtesy of Focus Features. © 2 – © 2024 Focus Features, LLC. All Rights Reserved., Quelle: http://www.imdb.com)