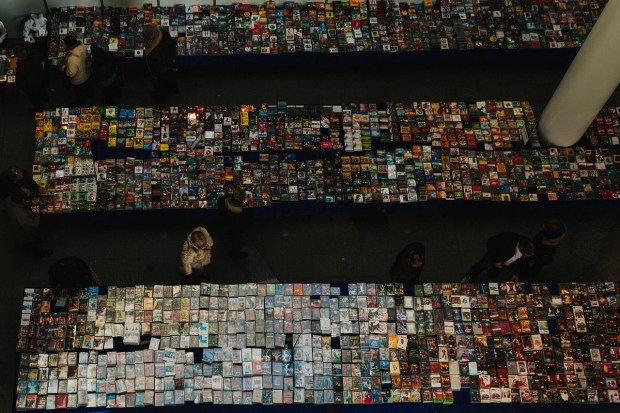Regie: Giorgos Lanthimos
Original-Titel: The Favourite
Erscheinungsjahr: 2018
Genre: Drama, Komödie, Historienfilm, Biopic
IMDB-Link: The Favourite
Giorgos Lanthimos hat es mit Tieren. In „Dogtooth“ redet ein Vater seinen Kindern ein, dass das gefährlichste Tier der Welt die Katze sei. In „The Lobster“ verwandelt er gleich paarungsunfähige Zeitgenossen in Tiere. Und in „The Favourite“ gibt es Entenrennen zu bestaunen und Kaninchen, die stellvertretend für die toten Kinder der Königin herhalten müssen. Im Gegensatz zu seinen früheren Werken gibt sich Lanthimos in seinem neuesten Werk allerdings erstaunlich zugänglich. Vordergründig ist „The Favourite“ ein Kostümfilm über die unfähige Queen Anne (zum Niederknien gespielt von Olivia Colman) und den Intrigen an ihrem Hof, befeuert durch ihre enge Vertraute und Ratgeberin Lady Marlborough (Rachel Weisz, smells like Oscar spirit) und der tief gefallenen Adeligen Abigail (Emma Stone, die ihren Kolleginnen um nichts nachsteht), die sich wieder nach oben arbeiten möchte in der Gesellschaft. Und die mit ihren Ambitionen naturgemäß die Stellung von Lady Marlborough bedroht, was diese nicht auf sich sitzen lassen möchte. Zwischen diesen beiden intriganten Damen und der Königin förmlich zermalmt werden die männlichen Figuren, die hier definitiv nichts zu melden haben. Frauenpower ist angesagt in Lanthimos‘ Werk, und das auf eine so schauerlich bitterböse Weise, dass einem schier die Luft wegbleibt und man eigentlich nur noch Mitleid mit den Figuren hat – mit allen nämlich. Genüsslich seziert Lanthimos Machtgefälle und Abhängigkeiten und kommt am Ende zu einem konsequenten Schluss: Intrigen gehen nie gut aus, am Ende sind alle verletzt. Der Weg zu dieser Erkenntnis ist dekadent ausgestattet, hinreißend gespielt, mit scharfzüngigen Dialogen und herrlich unkonventionellen Szenen gespickt – und immer wieder für eine Überraschung gut, in der Lanthimos zeigt, dass Authentizität nicht sein Ding ist, sondern vielmehr die innere Logik und Dramaturgie der Welt, die er filmisch vermisst. Und die ist immer stimmig, selbst wenn sie für die seltsamste und denkwürdigste Tanzeinlage seit „Pulp Fiction“ sorgt.
8,5
von 10 Kürbissen