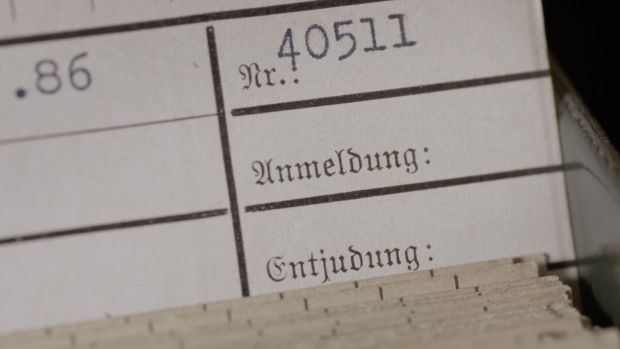Regie: Shinsuke Sato
Original-Titel: Inuyashiki
Erscheinungsjahr: 2018
Genre: Action, Komödie, Fantasy, Science Fiction
IMDB-Link: Inuyashiki
Herr Inuyashiki ist schon etwas in die Jahre gekommen. Für seine Firma verkauft er recht erfolglos mit Mineralen angereichertes Sportwasser, seine Kinder verachten ihn, ihm läuft ein Hund zu, den seine Frau nicht im Haus haben will, und dann bekommt er noch die Diagnose: Krebs. Drei Monate zu leben. Da kann man es schon nachvollziehen, wenn der gute Mann zum nächtlichen Sinnieren in den Park geht. Dort ist er aber nicht allein. Er bekommt Gesellschaft durch einen High School Schüler – und seltsame Entitäten, die ihn ausknocken. Als Inuyashiki wieder zu sich kommt, ist fortan alles ein bisschen anders. Denn das nächtliche Rendezvous mit den Gästen From Outer Space hat ihm ein paar lässige Zusatz-Features eingebracht. Einen Düsenantrieb zum Beispiel, oder einen Waffe im Arm, und nicht zuletzt die Fähigkeit zu heilen. Damit kann man schon ein paar nette Dinge anstellen. Nur blöd, dass sich an seiner Rolle als gering geschätzter Familienvater erst einmal nichts geändert hat. Und noch blöder, dass der Junge, der in jener Nacht ebenfalls im Park war, die gleichen Special Effects mitbekommen hat, diese schneller zu beherrschen versteht und mit einer Mordswut im Bauch gleich mal ganz Japan den Krieg erklärt. So muss der betagte Bürohengst seine Düsen in die Hand nehmen und hinausziehen ins Gefecht. Die japanische Live-Action-Verfilmung des Animes „Last Hero Inuyashiki“ ist ein durchaus spaßiges und actionreiches Vergnügen mit soliden visuellen Effekten und einem sympathischen Anti-Helden als Hauptfigur. Wenn der völlig überforderte Inuyashiki zum ersten Mal mit seinen neuen Modifikationen konfrontiert wird, sind seine Reaktionen darauf brüllend komisch anzusehen. Was dem Film aber eindeutig fehlt, ist eine nachvollziehbare Handlung. Zwar wird versucht, dem Bösewicht auch eine Geschichte zu geben, aber es bleibt dennoch völlig unschlüssig, warum er dermaßen austickt. Und das ist schade, denn dadurch wird der Film auf ein spaßiges Action-Abenteuer reduziert, das die wirklich tolle Grundprämisse, nämlich den alltägliche Büroangestellten zum Superhelden zu machen, nicht wirklich ausspielen kann. Dennoch hatte ich im Kino meinen Spaß mit dem Film, auch wenn er kaum im Gedächtnis hängenbleiben wird.
(Dieser Film ist als Reiseetappe # 64 Teil meiner Filmreisechallenge 2018. Mehr darüber hier.)
5,5
von 10 Kürbissen
(Foto: /slash Filmfestival)