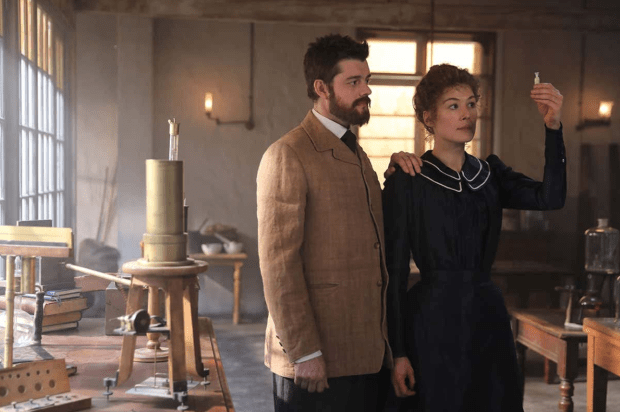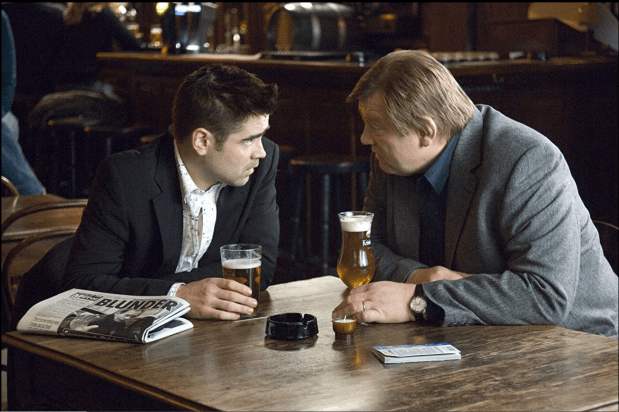Regie: Jean-Jacques Annaud
Original-Titel: Seven Years in Tibet
Erscheinungsjahr: 1997
Genre: Drama, Abenteuerfilm, Biopic
IMDB-Link: Seven Years in Tibet
Das Wandern ist des Harrers Lust … Und weil das so ist und weil die Nazis ein paar Erfolgsmeldungen brauchen können, wird eben jener (Brad Pitt) zusammen mit einigen anderen erfahrenen Bergsteigern, darunter Peter Aufschnaiter (David Thewlis), zum Nanga Parbat geschickt, um den „Schicksalsberg“ der Deutschen ein für alle Mal in die Knie zu zwingen. Nun kommt ihnen eine Kleinigkeit dazwischen, ein Weltkrieg nämlich. Und die Briten, die ebenfalls gerade in der Gegend der Welt herumturnen, sacken die deutsch-österreichische Expedition gleich mal fröhlich ein und kerkern sie in Britisch-Indien ein. Nach Jahren können Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter flüchten und schlagen sich über den Himalaya bis ins ferne Tibet durch. Dort wurde gerade ein junges Bürschli (Jamyang Jamtsho Wangchuk) zum neuen Dalai Lama erkoren – eben jener, dessen Lebensweisheiten heute auf allen Zitate-Kalendern zu finden sind. Und weil das Leben manchmal die besten Geschichten schreibt, erfährt der arrogante Pimpf Harrer dort am Dach der Welt seine Läuterung, die in einer tiefen Freundschaft zum Dalai Lama mündet, die bis ans Lebensende von Harrer gehalten hat. Doch das Leben ist eben nicht nur bunter Fernsehkitsch, und die Spannungen zwischen China und dem friedliebenden, buddhistischen Tibet nehmen zu. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt, und die zeigt Jean-Jacques Annaud in seinem Monumentalepos auch in aller Brutalität. Insgesamt kann man am Film durchaus seine Einseitigkeit und Parteinahme kritisieren, auch seine Verkürzung der komplexen Historie, aber wirkungsvoll ist er, keine Frage. Etwas schmerzhafter ist wohl eher der österreichische Akzent, um den sich Brad Pitt und David Thewlis bemühen. Ab dem Zeitpunkt, an dem sie nicht mehr versuchen, auf „Deutsch“ zu parlieren, wird’s besser. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass mit Harrers opportunistischer Einstellung zum NS-Regime etwas zu salopp umgegangen bzw. diese schlicht negiert wird. Und natürlich trieft zeitweise der Kitsch in diesem Film von den Bergwänden herunter. Aber gut, das waren halt die 90er, und damit ist Annaud ausreichend entschuldigt. Unterm Strich bleibt ein Film, der sein zentrales Thema, Freundschaft und Kameradschaft, mit eindrucksvollen Bildern zu untermalen weiß.
6,5
von 10 Kürbissen
(Bildzitat: Photo by Archive Photos/Getty Images – © 2012 Getty Images, Quelle http://www.imdb.com)